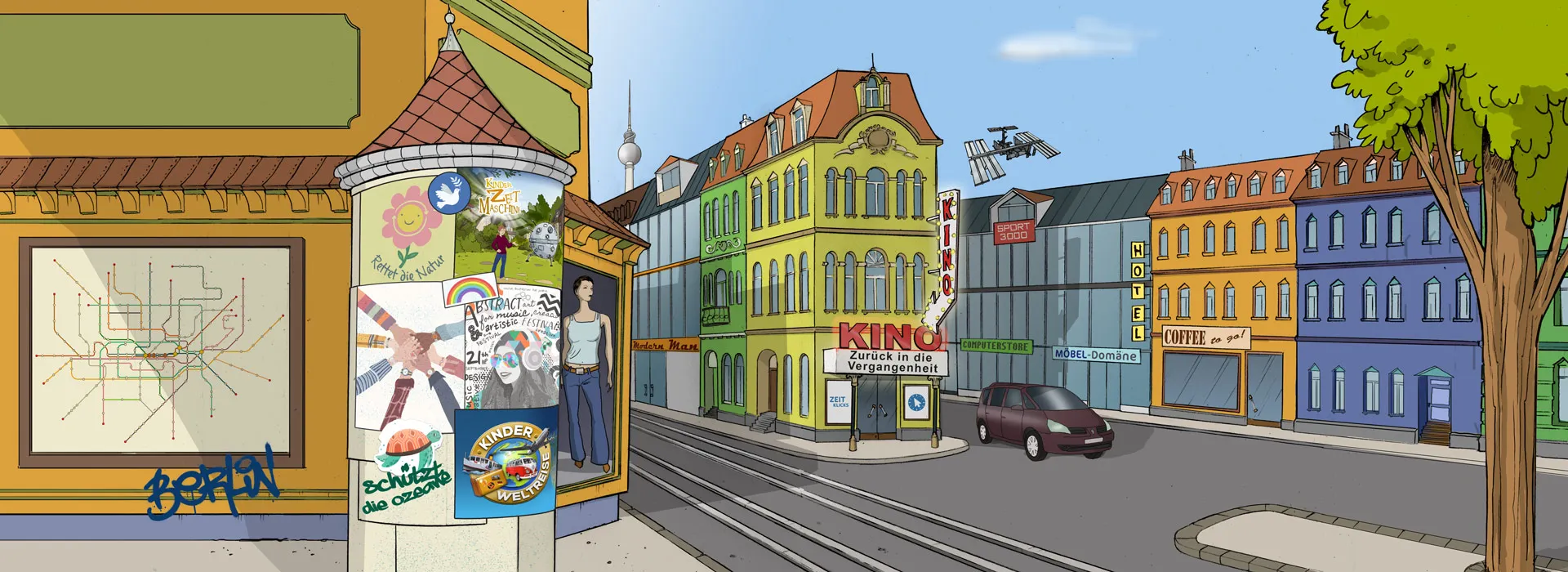Volksentscheid zur Fürstenenteignung
20.06.1926
Was ist Fürstenenteignung?



Während der Novemberrevolution waren die deutschen Fürsten entmachtet worden – einige freiwillig, andere gegen ihren Willen. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt. Es wurde ihnen weggenommen, war aber noch in ihrem Besitz. Die Frage stellte sich aber nun, was mit dem beschlagnahmten Vermögen geschehen sollte. Bei einer Enteignung, also der tatsächlichen Wegnahme des Besitzes, musste eine Entschädigung gezahlt werden. So sah es das Gesetz vor.
Es gab dann aber oft langwierige Verhandlungen der einzelnen Länderregierungen mit ihren ehemaligen Fürstenhäusern. Häufig ging es um große Ländereien, die insbesondere für kleinere Länder wie Mecklenburg-Strelitz von hoher wirtschaftlicher Bedeutung waren. Für große Länder wie Bayern oder Preußen waren diese meist weniger wichtig.
Da viele monarchisch gesinnte Richter im Amt verblieben waren, entschieden sie bei gerichtlichen Auseinandersetzungen häufig im Sinne der ehemaligen Fürsten. Sie sprachen ihnen entweder eine hohe Geldsumme zu oder gaben ihnen Land sogar zurück.
Gesetzesentwurf der KPD: Enteignet die Fürsten
Die KPD brachte schließlich einen Gesetzesentwurf zur entschädigungslosen Fürstenenteignung auf den Weg. Bauern sollten die Ländereien erhalten, die Schlösser zu Wohnungen oder Genesungsheimen umgebaut werden, Kriegsbeschädigte sollten Bargeld bekommen. Entschieden werden sollte per Volksbegehren.
Die SPD schloss sich nach erstem Zögern an, aber auch viele Wähler der Zentrumspartei oder der DDP waren für die Enteignung.
Volksbegehren: erfolgreich
Vom 4. bis 17. März 1926 wurde das Volksbegehren durchgeführt. Um erfolgreich zu sein, mussten 10 Prozent der Wahlberechtigten sich in ausgelegte Listen eintragen. Das bedeutete, dass knapp 4 Millionen Menschen das tun mussten – tatsächlich trugen sich mehr als 12 Millionen ein. Damit war das Volksbegehren erfolgreich.
Der Weg zum Volksentscheid
Nun musste der Reichstag über den Gesetzesentwurf zur Fürstenenteignung entscheiden. Da er hier abgelehnt wurde, erfolgte nun laut Gesetz ein Volksentscheid. Damit der Volksentscheid gültig werden würde, musste mindestens die Hälfte aller Wahlberechtigten teilnehmen und zustimmen. Der Termin wurde auf den 20. Juni 1926 festgelegt.
Propaganda für und gegen den Volksentscheid
Mehrere Wochen waren noch Zeit bis dahin und nun machten alle Gruppierungen und alle Parteien mobil. Parteien wie die DNVP und die BVP sprachen sich genauso gegen die Fürstenenteignung aus wie die Katholische und die Evangelische Kirche.
Vor allem die Angst vor einer Privatenteignung, die einer Enteignung der Fürsten folgen könne, ging um. Nicht ganz zu Unrecht wohl, denn in der KPD gab es auch dafür Fürsprecher.
Hindenburg: Fürstenenteignung ist verfassungswidrig
Gegen das Gesetz war auch Reichspräsident Hindenburg. Durch sein Einschreiten wurde die Mindestanzahl an zustimmenden Stimmen erhöht, denn er hielt das Gesetz für verfassungswidrig, weil die Enteignung der Fürsten nicht dem Wohl der Allgemeinheit diene, sondern eine Vermögenshinterziehung aus politischen Gründen sei.
Die Regierung Luther stimmte dem zu. Da es sich also um eine Verfassungsänderung handeln würde, war die Mehrheit der Wahlberechtigten erforderlich – und nicht nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 20 Millionen Wähler mussten für den Erfolg des Entscheids zustimmen.
Das Scheitern des Volksentscheids
Am 20. Juni gingen jedoch nur 15, 6 Millionen Wähler zur Abstimmung. 14,5 Millionen stimmten mit "Ja". Damit war der Volksentscheid gescheitert.
Die Folgen: Verhandlungen und Vergleiche
Eine Einigung mit den Fürstenhäusern musste in Zukunft durch direkte Verhandlungen erzielt werden. So kam es meist zum Vergleich, das heißt das Land (z. B. Preußen) erhielt ein Teil Land und ein Teil der Schlösser und Gärten, der andere Teil verblieb bei dem Fürstenhaus.
Theater, Museen oder Bibliotheken, die einst den Fürsten gehört hatten, wurden häufig in Stiftungen umgewandelt und waren nun der Öffentlichkeit zugänglich.
Was noch alles im Jahr 1926 passierte, siehst du unter 1926. Auf dem Zeitstrahl oben kannst du außerdem jedes einzelne Jahr anklicken.