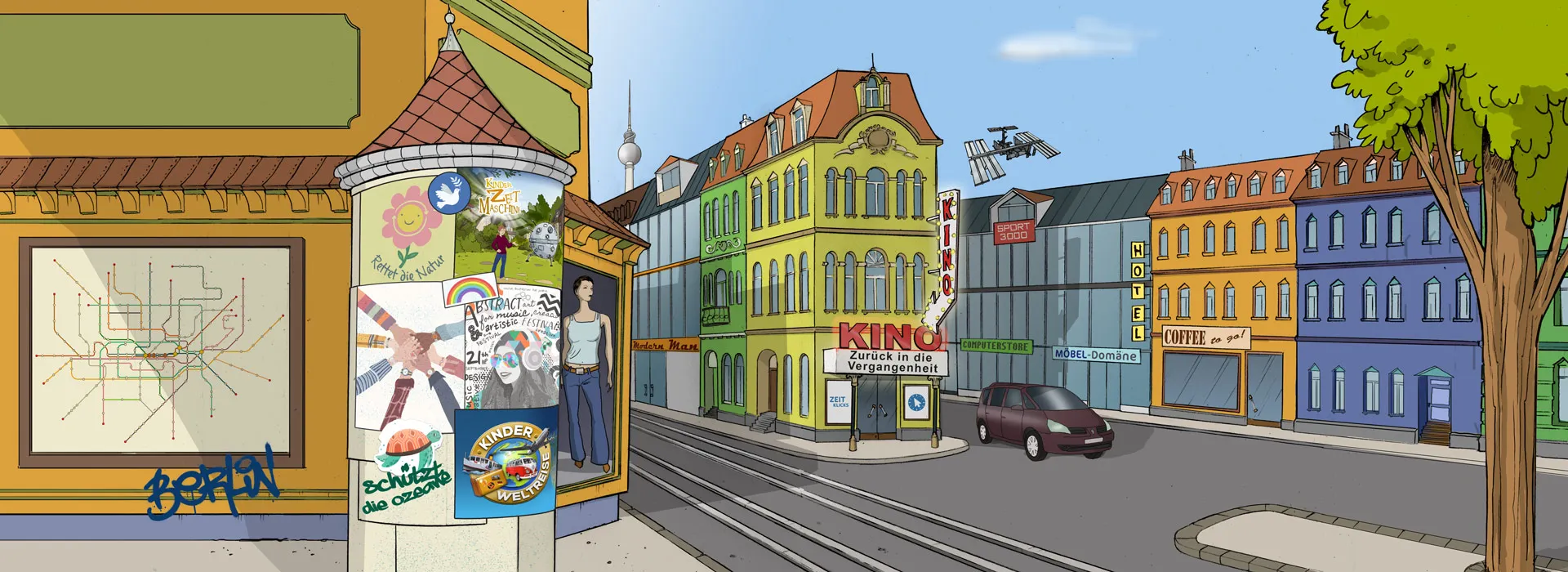Besetzung des Ruhrgebiets
11. - 16. 1. 1923
Ruhrbesetzung 1923

Das Jahr 1923 wurde zum größten Krisenjahr der Weimarer Republik. Die Besetzung des Ruhrgebiets gehörte dazu und führte schließlich zum Ruhrkampf.
Wie kam es zur Ruhrbesetzung? Deutschland war mit der Zahlung der Kriegsentschädigung (Reparationen) in Verzug geraten. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage Deutschlands hatten die siegreichen Westmächte schon auf Zahlungen in Form von Geld verzichtet und Sachlieferungen akzeptiert, insbesondere Kohle und Telegrafenmasten.
Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen
Als diese nun auch nicht termingerecht geliefert wurden, besetzten belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet. Es sollte als Pfand dienen.
Da im Ruhrgebiet besonders viel Kohle produziert wurde und da es zu einer entmilitarisierten Zone gehörte, in der sich Deutschland also nicht durch Soldaten verteidigen konnte, eignete sich das Ruhrgebiet aus Sicht der Franzosen besonders gut für eine solche Besetzung.
Insgesamt marschierten 60.000 Mann ins Ruhrgebiet ein. Großbritannien hatte sich gegen die Besetzung ausgesprochen. Der Konflikt Deutschlands mit Frankreich befand sich nun auf dem Höhepunkt.
Widerstand im Ruhrkampf
Doch es regte sich Widerstand. Schon am 13. Januar rief die Regierung unter Reichskanzler Wilhelm Cuno zum passiven Widerstand auf. Die Reparationszahlungen wurden nun vollständig eingestellt.
Die Arbeiter streikten. Sie kamen also ihrer Arbeit nicht mehr nach. Der Verkehr, die Industrie und die Verwaltung arbeiteten nicht mehr. Gewaltsam wurden Zerstörungen vorgenommen, etwa an Eisenbahnen. Man sprach vom Ruhrkampf.
Obwohl die Arbeiter streikten, zahlte der Staat ihnen ihren Lohn. Weil das Geld dafür aber fehlte, druckte man es kurzerhand. Das aber führte zu Hyperinflation. Der Wert des Geldes verfiel.
Ende des Ruhrkampfes
Im September 1923 beendete der neu gewählte Reichskanzler Gustav Stresemann schließlich den passiven Widerstand. Eine Währungsreform beendete die Inflation. 1924 endete schließlich auch die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen.
Was noch alles im Jahr 1923 passierte, siehst du unter 1923. Auf dem Zeitstrahl oben kannst du außerdem jedes einzelne Jahr anklicken.